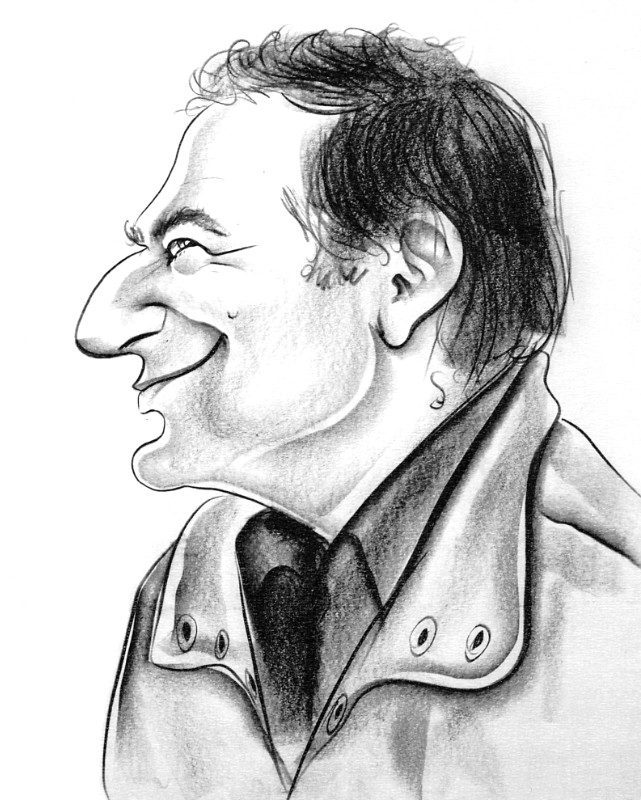Die von Journalisten mehr als ein Viertel Jahrhundert nach der Wende oft gestellte Frage an einstige DDR-Bürger nach ihrer persönlichen Zufriedenheit, beantworten selbst die hartgesottensten Gestrigen mehrheitlich positiv. Manch einer sogar euphorisch.
Als ich unlängst meine örtliche Sparkassenfiliale aufsuchte, um eine Fehlabbuchung mit einer Null zu viel vor dem Komma korrigieren zu lassen, verwies mich die junge Angestellte an den Chef, Herrn Bradhering ….. „aber mit De statt Te !“, wie sie lächelnd hinzufügte Immerhin – egal ob mit De oder Te – ein außergewöhnlicher Name, der mich allerdings an einen ehemaligen Klassenkameraden dieses Namens erinnerte. Ich fand ihn damals gar nicht so schräg, da Ecki, wie wir ihn nannten. vom Darß stammte. Vielleicht hatten seine Vorfahren die Zubereitung jenes Gerichts – allerdings mit T – einmal erfunden.
Chef Bradhering stellte sich als beleibter, freundlicher Mittfünfziger heraus, dem eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem einstigen Klassenkumpel nicht abzusprechen war.
Neben erfolgreicher Korrektur der Null einschließlich einer Entschuldigung, erfuhr ich schließlich auch das Verwandtschaftsverhältnis. Er war Eckis Sohn..
Über seinen Werdegang – wie ich mich erinnerte – hatte mir Ecki bei einem unserer späteren Klassentreffen berichtet. Als Vater, der wie selbstverständlich sich erfolgreiche Nachkommen gewünscht hatte, gab er seiner Enttäuschung über die Berufswahl Ausdruck. Eine akademische Laufbahn seines Sohnes Maik hätte ihn mit Stolz erfüllt.
So aber hatte Maik Ende der siebziger Jahre nach der zehnten Klasse in einer Brandenburgischen Kleinstadt eine Lehre als Bankkaufmann bei der örtlichen Sparkasse aufgenommen, da sein Zensurendurchschnitt für einen Platz in der Erweiterten Oberschule mit Abi-Abschluss höchstens dazu ausgereicht hätte, sich vorzeitig zu verpflichten, um nach dem Abitur eine Offizierskariere bei der NVA anzutreten. Davor riet ihm Vater Ecki jedoch ab, was Maik schon insofern akzeptierte, da Khaki und Grünbunt nicht nach seinem Geschmack waren. Alsbald empfand er jedoch, dass er auch als läppischer Bankkaufmann wohl die Arschkarte gezogen hatte, wie er sich seinerzeit ausdrückte, da im A.- und B.-Staat dieser Beruf weder ein privilegiertes Image hatte noch Maiks monatliche Bedürfnisse abdeckte.Als Klempner zum Beispiel konnte man – wie sein Busenfreund Timmi – nach Feierabend noch richtig Knete machen – und das sei ja letztendlich der eigentliche Sinn eines Jobs. Sein einziger Trost war lediglich, dass man weder in anderer Leute Scheiße rumstochern musste, noch sich jedweden Witterungsunbilden aussetzen musste.
Doch es war schon ärgerlich, dass er die Gelegenheit nich wahrnehmen konnte, als ihm ein achtzigjähriger Nachbar, dem er ab und zu einen Gefallen tat, seinen erst fünf Jahre alten Trabi anbot, und das lediglich zum Neupreis. Er hatte eben das nötige Sümmchen nicht. Für einen popligen Sparkassenangestellten war selbst so ein Schnäppchen unbezahlbar..
So dümpelte er dahin, und wenn er die flotte Frisörin Peggy nicht kennen gelernt hätte, die neunzig Prozent ihres damit hinreichenden Auskommens aus Trinkgeldern und Feierabendkundschaft bestritt, wären die Wochenenden samt der Disco-Abende recht ernüchternd ausgefallen.
Aus Dankbarkeit schwängerte er Peggy alsbald, um in der Folge noch rechtzeitig vor den Vaterfreuden in den Hafen der Ehe einzulaufen und damit das Recht auf Antrag für eine Wohnung zu erwerben.
Das alles aber ist nur die Vorgeschichte jenes nicht vorhersehbaren Aufstiegs in einem Land mit freier Wirtschaft, in dem man nunmehr als Bankkaufmann auch ohne Feierabendjob sein gesichertes Auskommen samt Image hat.
„Grüßen Sie ihren Vater von mir!“, sagte ich beim Abschied. „Er wird sich sicher noch gern an gemeinsame – sagen wir Erlebnisse – erinnern. Wie geht es ihm?“ Bradhering Junior schmunzelte. „Irgendwann nach der Wende überraschte er mich, als er mich ansah und sagte: „Vielleicht hätte ich statt Kunstgeschichte zu studieren, eine Banklehre vorziehen sollen.“