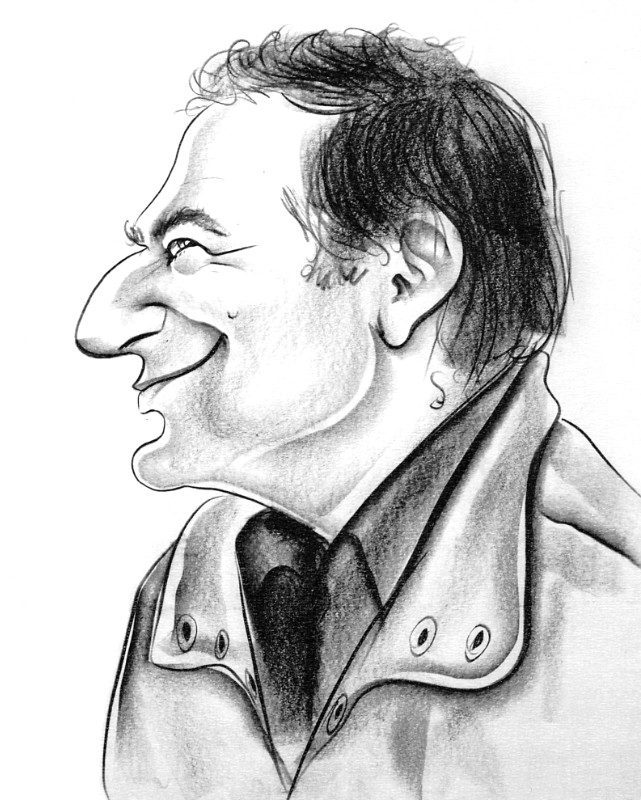Alljährlich, wenn die Schoko-Weihnachtsmänner in den Regalen der Supermärkte bereits ihre dreimonatige Standhaftigkeit bewiesen haben und die Jahreswende naht, verlagert sich unser Augenmerk vom gewohnten Alltagstrott auf die bevorstehenden Festivitäten mit den Tauschaktionen von Objekten, die wir als gegenseitige Geschenke bezeichnen, (wobei strengstens auf einen gerechten „Wertausgleich“ zu achten ist!) Allerdings selten nur erweisen sich diese sogenannten Geschenke als nützlich, meist sind sie überflüssige oder gar Sinn entbehrende Gaben, die letztendlich in Nebengelassen landen oder im günstigsten Fall für den Beschenkten wiederum als Geschenk missbraucht werden können. Eigentlich wäre ja ein absoluter Verzicht auf diesen Tauschhandel die perfekte Alternative, wenn uns unser Gewissen nicht einen unumgänglichen Zwang dazu auferlegen würde, da ja die Vermutung nahe liegt, selbst von dem zu Beschenkenden ein Geschenk zu erhalten und keine Gegenleistung erbracht zu haben. Und das wäre ja äußerst peinlich.
Unabhängig von dieser Problematik ist es mit dem Kalenderblatt: Dezember höchste Zeit, sich um den Jahresend-Dekoschmuck zu kümmern. Dieser ist bei uns auf dem Dachboden deponiert und würde inzwischen ausreichen, um sämtliche Wohnräume in den Häusern unserer Straße festlich auszustatten.
Bei der Auswahl für meine diesjährige Raumausstattung stieß ich unvermutet auf ein Objekt, das vermutlich Jahre zuvor versehentlich in einem der Aufbewahrungs-Kartons gelandet war und in absolute Vergessenheit geriet. Es war eine außergewöhnliche Flasche, handbemalt mit vielfarbigen Ornamenten, ähnlich wie man es von kunsthandwerklich verzierten Ostereiern kennt.
Der Inhalt befand sich noch in der Flasche, und das Etikett verriet mir ein Weingut und das Erzeugerjahr. Es handelte sich um einen Weißwein, Spätlese von 1999, fast zwanzig Jahre alt, also aus dem vorigen Jahrtausend – und dann: diese außergewöhnliche Bemalung!
Das alles veranlasste mich letztendlich zur sorgsamen Recherche hinsichtlich jenes Fundstücks, das mir wohl irgendwann zu irgendwelchem Jubiläum von irgendwem als Geschenk zuerkannt wurde.
Bei eingehender Betrachtung entdeckte ich einen Aufkleber mit dem Text: „Herzliche Glückwünsche zur Silberhochzeit von Brigitte und Dietmar“. Damit konnte ich zwar anfangs absolut nichts anfangen, doch mein Erinnerungsvermögen ließ mich nicht im Stich und ordnete Brigitte und Dietmar als Verschwägerte meinem Bruder zu, der einschließlich seiner Sippschaft nahe der Weinstraße beheimatet ist, jener Region, wo auch die favorisierte Lieblingsspeise des Kanzlers der „blühenden Landschaften“ seine Heimat hat, des Saumagens. Meine so gewonnene Erkenntnis entbehrte also nicht einer gewissen Logik. Das förderte schließlich meinen Forschungsdrang, der mich sogleich jenen Aufkleber vorsichtig entfernen ließ, da unter diesem eine zweite Botschaft versteckt schien, die vielleicht weitere Aufschlüsse zutage brächte, da ich ja die Silberhochzeit meines Bruders auf 2005 datieren konnte. Und so war es dann auch. Die nächste Aufschrift lautete : „Unserer stets aktiven Mit-Närrin Brigitte zur Jahrtausendwende! Dein K-K-K“ (*ein Karnevalsverein)
Nun waren die Umwege jener buntbemalten Flasche eindeutig geklärt, und wie ich mich zu guter Letzt erinnerte, erhielt ich sie von meinem Bruder zum achtzigsten Geburtstag, wonach sie wohl versehentlich mit der abgebauten Weihnachtsdekoration auf dem Dachboden gelandet ist – und das war bereits auch schon vor sieben Jahren. Ich beschloss, sie weiter zu verschenken. Wem aber?
Übermorgen war Nikolaustag, für den die gefüllten Tüten für die beiden Urenkel bereits bereit standen. Warum nicht eine dritte Tüte den Eltern? So landete jene Flasche schließlich bei meinem Enkel, dessen ehrliche Begeisterung über einen zwanzigjährigen Wein er im Endeffekt damit ausdrückte, dass er mich zum gemeinsamen Entkorken und anschließenden Umtrunk einlud. Meine heimlichen Bedenken, ob wir nach so vielen Stationen und langjähriger Lagerung auf dem Dachboden nicht vielleicht Essig in den Gläsern hätten, erwiesen sich schon beim ersten Schluck als unbegründet. Ansonsten möchte ich mich hinsichtlich der Qualität zurückhalten, da Spätlesen nicht so ganz meinem Geschmack entsprechen – auch wenn ich im Nachhinein erfuhr, dass es sich um einen sehr, sehr „teuren Tropfen“ handelte.
……Inzwischen waren fast drei Monate vergangen, als ich Post von meinem Bruder erhielt, ihm, der gewöhnlich alles Wichtige und Unwichtige mir am Telefon mitteilt. „…..Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst: Zu deinem Achtzigsten haben wir dir doch so eine bemalte Flasche Weißwein mitgebracht. Du wirst nicht glauben, was es mit dieser Flasche auf sich hat, aber lies es selbst. Anbei schicke ich dir die Kopie eines Artikels aus unserer regionalen Tageszeitung über den Bemaler dieser Flasche, der demzufolge inzwischen als ein international angesagter Popart-Künstler gilt.“ Bei aller Phantasie wollte ich es nicht glauben, was ich las: Da gab es also vor der Jahrtausendwende einen Gymnasiasten, der unter dem Pseudonym Andy Mundschenk ein paar Flaschen der Spätlese vom kaum bekannten kleinen Weingut seines Onkels Robert bemalt hatte. Eine jener künstlerisch verzierten Flaschen hatte Andys Schwester zur Jahrtausendwende ihrem aktuellen Laver geschenkt, der seinerzeit als Army-Angehöriger in Baumholder stationiert war. So landete dieses Geschenk fast zwei Jahrzehnte später letztendlich in San Francisco auf einer Auktion, wo es die stolze Summe von 85-Tausend Dollar erzielte.
Der Brief meines Bruders endete mit dem Satz, (der seiner Unwissenheit geschuldet war): „Hätteste dich damals zurückgehalten und die volle Pulle gut aufbewahrt, könnteste dir heute für die Knete ne ganze Wagenladung leisten. Nun aber weißt du endlich, was du mir schon damals wert warst.“
Ja, nun war sie tatsächlich leer, die Flasche, und so etwas wird scheinbar generell nicht als positiv bewertet, wenn man sich des Ausspruchs eines Fußballtrainers aus Bella Italia erinnert: „Flasche leer!“.