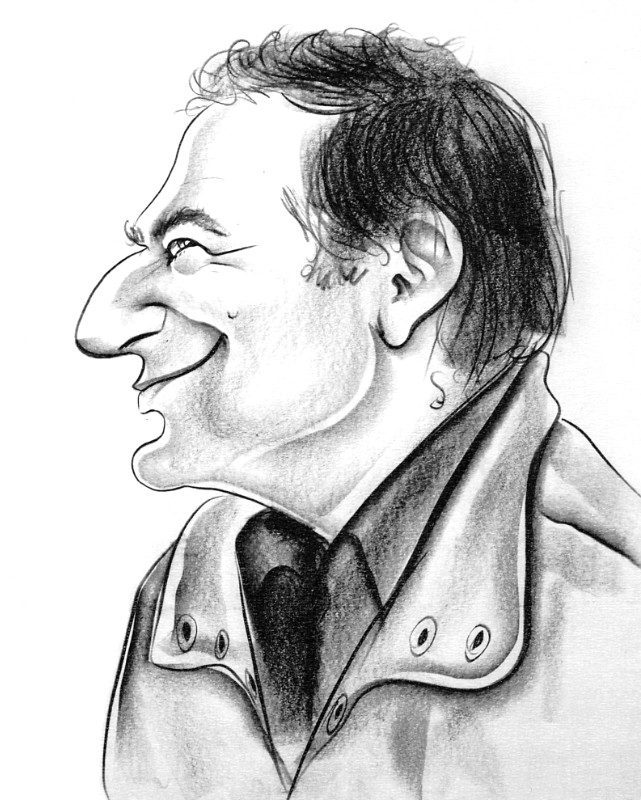Es ist noch nicht lange her, da trat sie im rosa Schlabberlook vor vollen Rängen auf und amüsierte ihr Publikum als Cindy aus Marzahn.
Auch, wenn nicht jedwede Darbietung jedermanns Sache ist, sollte man wohl seinen Hut ziehen vor der Frau, die damit Hartz vier hinter sich ließ.
Nun hat sie auch die Erfolge als Cindy hinter sich gelassen und mit kluger Selbsteinschätzung sich in Interviews zu ihrem neuen Leben unter ihrem bürgerlichen Namen bekannt. Ihr Resümee darüber, dass sie sich als Cindy von Marzahn nur vorübergehend in eine „Kunstfigur“ verwandelte, passte eigentlich so gar nicht zu den Erfahrungen, die ich von applausverwöhnten Bühnenkünstlern hatte, die doch stets auf alle Ewigkeit – mehr oder weniger abgehoben – ihre Persönlichkeit mit ihrem Erfolg gleich setzten. Ein erfolgreiches zweites „Ich“ einzugestehen, aus dem man freiwillig wieder aussteigt, zeugt schon von einer selten gewordenen Ehrlichkeit.
Damit war zwar der Fall „Cindy“ für mich abgeschlossen, nicht aber der Begriff „Kunstfigur“, und ich kam letztendlich zu dem Schluss, dass wir wohl alle hin und wieder – egal aus welchem Anlass, vorsätzlich oder unbewusst – in eine Kunstfigur schlüpfen. Dazu ist nicht Kunst vonnöten, es handelt sich dabei lediglich um ein „künstliches“ zweites Ich. Das beweist wohl den entscheidenden aber oft verkannten Unterschied zwischen den Attributen: künstlerisch und künstlich, für die mir als Beispiel der sogenannte Kunsthonig einfällt, der, außer, dass er ebenfalls süß schmeckt, nichts mit Honig gemein hat.
Inzwischen jedoch scheint man die stets prononciert betonte Freiheit der Kunst in diskriminierendem Maß als Scharlatanerie zu missbrauchen:
Unlängst sendete ein Fernsehprogramm einen Bericht über das „Haus am See“, einer Villa aus den 1920er Jahren in Berlin Zehlendorf, die sich über Jahrzehnte als Kunsthaus einen Namen machte mit Ausstellungen weltberühmter Künstler. (u.a. Picasso und Richter)
Nach grundlegender Sanierung steht nun – erfreulicher Weise – die Wiedereröffnung bevor.
Doch was die Sendung bot, zog mir fast die Socken aus:
Während die noch leeren Räumlichkeiten aufs Feinste prangten, versuchte man der Ästhetik der Fassade einen Stempel gegenwärtiger „Kunst“ aufzudrücken. Für mich: Unkultur in Reinkultur!
Handwerker bohrten Löcher in die gesamte Fassade zur Aufhängung von 53 unterschiedlich großen Flächen aus weiß grundierter Malleinwand auf Keilrahmen, wie sie Maler nutzen, um sie mit ihren Darstellungen zu Kunstwerken werden zu lassen – durch Fantasie und Können.
Eine junge Journalistin führte das Gespräch mit der Leiterin des Hauses, einer Dame, die sich – wenn ich mich recht erinnere – als Kuratorin darstellte, in überschwänglichen Worten ihren „künstlerischen“ Fassadenschmuck erläuterte und die Kunst darin sah, dass Sonne, Regen und Schnee (Ich glaube eher der Feinstaub) die noch weißen Flächen im Lauf der Zeit zu wundervollen Kunstwerken verwandeln werden.
Wie bitte? Das wäre etwa so, als würde der Leiter einer Philharmonie Trompetenblech an die Fassade nageln und darauf warten, das der Wind eine Melodie darauf spielt.
Doch noch einmal zurück zum „Haus am See“, in dessen Garten als Krone der Kunst ein Areal dargeboten wurde, an dem – wohl vor der Renovierung – der gesamte ausrangierte Krempel, wie Regale, Mobiliar und ein großer, angerosteter Kühlschrank einen Platz gefunden hatte, jene Stelle, die Frau Kuratorin mit dem Begriff „künstlerische Installation“ hochlöblich vorführte. Sie meinte es ernst!
Man kann ja über Kunst streiten, wenn es denn Kunst ist, aber sollte man total Bekloppten nicht besser ein eigenes Forum bieten, dass Kunst noch das bleibt, was der normale Mensch dafür hält?